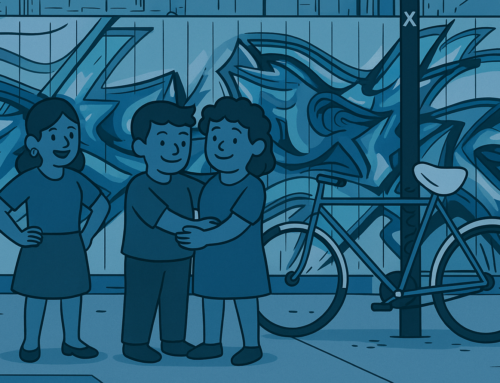Demokratie macht Schule?! Politische Bildung und Demokratiebildung an Berliner Schulen
Die neue FES-Studie „Demokratie macht Schule?!“ blickt aus der Perspektive von Berliner Schüler*innen auf politische Bildung – und zeichnet ein differenziertes Bild zwischen guter Grundlage und klaffenden Lücken. Seit der Reform 2019/20 ist Politik in den Klassen 7 bis 10 als eigenes Fach verankert; die Studie bilanziert nun erstmals die Praxis und bestätigt: Wo ausreichend Zeit, verlässliche Strukturen und ein zugewandtes Unterrichtsklima zusammenkommen, wächst politische Mündigkeit spürbar. Gleichzeitig zeigt sich eine deutliche Zäsur nach der 10. Klasse. Gerade an Oberstufenzentren und beruflichen Schulen berichten Jugendliche von weniger Politikunterricht und geringeren Gelegenheiten, Kontroversen einzuordnen, Debatten zu führen und Mitbestimmung zu erleben. Das schwächt Kompetenzaufbau und Selbstwirksamkeit – mit Folgen für Interesse, Vertrauen und Teilhabe.
Inhaltlich sehen viele Jugendliche Nachholbedarf bei Themen, die ihren Alltag prägen: Rechtsextremismus und Verschwörungserzählungen, Nachhaltigkeit/Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie digitale Mündigkeit werden zwar behandelt, aber oft nicht tief genug. Gleichzeitig macht die Studie Mut: Wo Schulen Demokratie als „Whole-School-Ansatz“ leben – also Unterricht, Schulkommunikation und echte Beteiligungsrechte zusammendenken –, fühlen sich junge Menschen ernst genommen und wirksam. Klassenrat, Schülervertretung und Beteiligungsprojekte entfalten Wirkung, wenn sie Mandate, Zeit und sichtbare Ergebnisse haben. Entscheidend ist dabei, soziale Ungleichheiten mitzudenken: Schulen mit vielen mehrsprachigen oder sozial benachteiligten Schüler*innen brauchen gezielte Ressourcen, Sprachbildung und Kooperationen mit außerschulischen Partnern.
Die zentrale Botschaft lautet daher: Politische Bildung wirkt – wenn sie konsequent ermöglicht wird. Mehr verbindliche Unterrichtszeit vor allem in der Sekundarstufe II, verlässliche Beteiligungsstrukturen und eine systematische Öffnung der Schule in Richtung Jugendparlamente, Träger politischer Bildung und partizipativer Projekte können die Kluft schließen. In Zeiten multipler Krisen ist das kein „Nice to have“, sondern demokratische Daseinsvorsorge. Die Berliner Reform liefert das Fundament; jetzt gilt es, Stundenpläne zu stärken, Curricula zu schärfen und Mitbestimmung vom Projekttag zur gelebten Praxis zu machen. Wer politische Teilhabe früh erfahrbar macht, schützt nicht nur vor menschenfeindlichen Einstellungen – er stärkt eine demokratische Kultur, in der junge Menschen nicht Objekte von Bildung sind, sondern Subjekte, die ihre Schule und Gesellschaft mitgestalten.
Demokratie macht Schule?! Politische Bildung und Demokratiebildung an Berliner Schulen
Die neue FES-Studie „Demokratie macht Schule?!“ blickt aus der Perspektive von Berliner Schüler*innen auf politische Bildung – und zeichnet ein differenziertes Bild zwischen guter Grundlage und klaffenden Lücken. Seit der Reform 2019/20 ist Politik in den Klassen 7 bis 10 als eigenes Fach verankert; die Studie bilanziert nun erstmals die Praxis und bestätigt: Wo ausreichend Zeit, verlässliche Strukturen und ein zugewandtes Unterrichtsklima zusammenkommen, wächst politische Mündigkeit spürbar. Gleichzeitig zeigt sich eine deutliche Zäsur nach der 10. Klasse. Gerade an Oberstufenzentren und beruflichen Schulen berichten Jugendliche von weniger Politikunterricht und geringeren Gelegenheiten, Kontroversen einzuordnen, Debatten zu führen und Mitbestimmung zu erleben. Das schwächt Kompetenzaufbau und Selbstwirksamkeit – mit Folgen für Interesse, Vertrauen und Teilhabe.
Inhaltlich sehen viele Jugendliche Nachholbedarf bei Themen, die ihren Alltag prägen: Rechtsextremismus und Verschwörungserzählungen, Nachhaltigkeit/Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie digitale Mündigkeit werden zwar behandelt, aber oft nicht tief genug. Gleichzeitig macht die Studie Mut: Wo Schulen Demokratie als „Whole-School-Ansatz“ leben – also Unterricht, Schulkommunikation und echte Beteiligungsrechte zusammendenken –, fühlen sich junge Menschen ernst genommen und wirksam. Klassenrat, Schülervertretung und Beteiligungsprojekte entfalten Wirkung, wenn sie Mandate, Zeit und sichtbare Ergebnisse haben. Entscheidend ist dabei, soziale Ungleichheiten mitzudenken: Schulen mit vielen mehrsprachigen oder sozial benachteiligten Schüler*innen brauchen gezielte Ressourcen, Sprachbildung und Kooperationen mit außerschulischen Partnern.
Die zentrale Botschaft lautet daher: Politische Bildung wirkt – wenn sie konsequent ermöglicht wird. Mehr verbindliche Unterrichtszeit vor allem in der Sekundarstufe II, verlässliche Beteiligungsstrukturen und eine systematische Öffnung der Schule in Richtung Jugendparlamente, Träger politischer Bildung und partizipativer Projekte können die Kluft schließen. In Zeiten multipler Krisen ist das kein „Nice to have“, sondern demokratische Daseinsvorsorge. Die Berliner Reform liefert das Fundament; jetzt gilt es, Stundenpläne zu stärken, Curricula zu schärfen und Mitbestimmung vom Projekttag zur gelebten Praxis zu machen. Wer politische Teilhabe früh erfahrbar macht, schützt nicht nur vor menschenfeindlichen Einstellungen – er stärkt eine demokratische Kultur, in der junge Menschen nicht Objekte von Bildung sind, sondern Subjekte, die ihre Schule und Gesellschaft mitgestalten.
Weitere Beiträge
Du hast noch nicht genug? Hier findest du mehr.

Kontakt
Wir freuen uns über deine Nachricht! Du kannst uns per E‑Mail, Telefon oder Brieftaube erreichen. Unser Team hilft dir gerne weiter.
Servicestelle Jugendbeteiligung
Scharnhorststraße 28/ 29
10115 Berlin
post@jugendbeteiligung.info
030 / 387 845 20